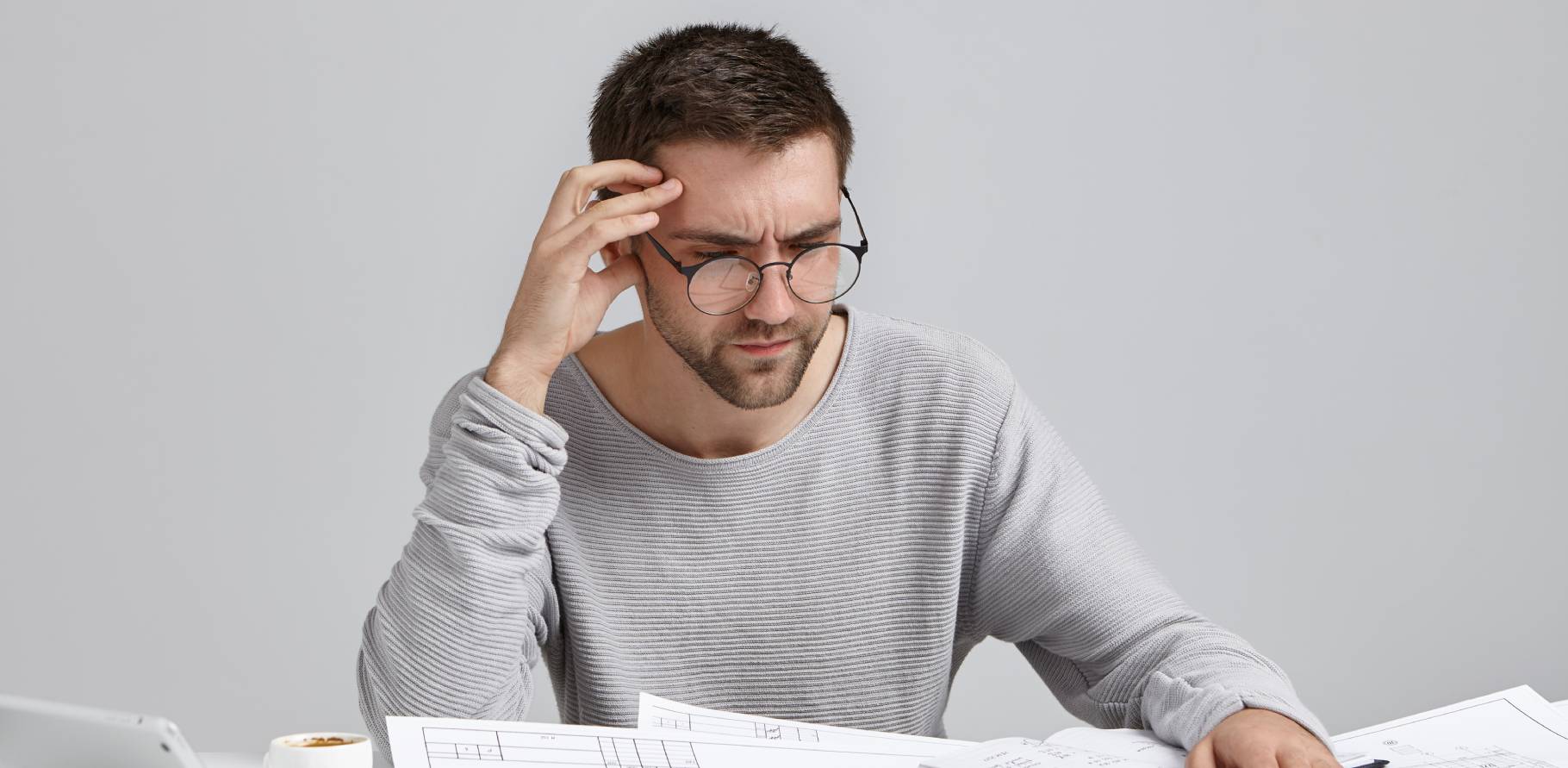Die private Unfallversicherung ist für viele Menschen ein wichtiger Schutz, um finanzielle Folgen eines Unfalls abzufedern. Ein zentraler Begriff im Zusammenhang mit der Unfallversicherung ist die Invalidität, die oft über die Höhe der Leistungen entscheidet. Wir klären, was Invalidität in der privaten Unfallversicherung bedeutet, welche Fristen Versicherungsnehmer beachten sollten und mit welchen Einwendungen seitens der Versicherungen häufig zu rechnen ist.
Wirth Rechtsanwälte unterstützen Sie als Fachanwälte für Versicherungsrecht bei der Durchsetzung Ihrer Versicherungsansprüche gegenüber der Unfallversicherung. Kontaktieren Sie uns!
Invalidität in der privaten Unfallversicherung: Bedeutung und Beispiele
Der Begriff Invalidität spielt eine wesentliche Rolle in der privaten Unfallversicherung und bezieht sich auf dauerhafte körperliche oder geistige Beeinträchtigungen, die durch einen Unfall verursacht wurden. Die Invaliditätsleistung ist eine der wichtigsten Leistungen der Unfallversicherung und soll die finanziellen Folgen einer bleibenden Beeinträchtigung abmildern. Wir erklären, was Invalidität im Detail bedeutet, wie sie bewertet wird und welche Faktoren Versicherungsnehmer beachten sollten.
Gerechtigkeit ist unser Antrieb
Was bedeutet Invalidität in der Unfallversicherung?
Invalidität in der Unfallversicherung bedeutet, dass eine Person durch einen Unfall dauerhaft in ihrer körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist. Die Beeinträchtigung muss gemäß den Vertragsbedingungen der Versicherung als dauerhaft gelten, was in der Regel bedeutet, dass sie mindestens ein Jahr nach dem Unfallereignis noch besteht.
- Dauerhaft: Die Einschränkung durch den Unfall darf nicht vorübergehend sein, sondern muss als bleibend angesehen werden.
- Direkter Unfallzusammenhang: Die Beeinträchtigung muss direkt auf einen Unfall zurückzuführen sein. Krankheiten oder andere Ursachen sind in der Regel ausgeschlossen.
- Körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit: Die Einschränkung kann sowohl physisch (z. B. Verlust eines Gliedmaßes) als auch mental (z. B. kognitive Beeinträchtigungen) sein.
Beispiel 1 Invalidität: Verlust eines Fingers
Ein Tischler verliert durch einen Unfall an der Kreissäge seinen rechten Zeigefinger. Der Verlust ist dauerhaft und beeinträchtigt seine berufliche Tätigkeit erheblich. In diesem Fall würde eine Invaliditätsleistung fällig, basierend auf der Gliedertaxe (siehe unten).
Beispiel 2 Invalidität: Sehbehinderung nach einem Sturz
Eine Person stürzt schwer und erleidet nach dem Unfall eine Verletzung am Kopf, die zur dauerhaften Einschränkung des Sehvermögens auf einem Auge führt. Auch hier würde Invalidität vorliegen, wenn die Beeinträchtigung dauerhaft und auf den Unfall zurückzuführen ist.
Die Leistung der privaten Unfallversicherung im Fall einer Invalidität bemisst sich an der sogenannten Gliedertaxe, einer Tabelle, die prozentuale Invaliditätsgrade für den Verlust oder die Funktionsbeeinträchtigung bestimmter Körperteile oder Sinne festlegt.
Gliedertaxe & Invalidität: Grundlage der Leistungsermittlung
Die Gliedertaxe ist eine verbindliche Bewertungsskala für den Invaliditätsgrad, die in den Vertragsbedingungen der privaten Unfallversicherung festgelegt ist. Die Gliedertaxe definiert, welchen Invaliditätsgrad der Verlust oder die Funktionsunfähigkeit eines bestimmten Körperteils oder Organs hat. Beispiele aus einer typischen Gliedertaxe sind Folgende:
- Verlust eines Arms: 70 % Invaliditätsgrad
- Verlust eines Beines: 60 % Invaliditätsgrad
- Verlust eines Auges: 50 % Invaliditätsgrad
- Verlust eines Daumens: 20 % Invaliditätsgrad
- Verlust eines Zeigefingers: 10 % Invaliditätsgrad
Wenn mehrere Körperteile betroffen sind, können die Invaliditätsgrade addiert werden, jedoch meist bis zu einer maximalen Obergrenze von 100 %.
Beispiel Invaliditätsgrad: Ein Versicherter verliert durch einen Unfall seinen rechten Arm (70 %) und ein Auge (50 %). Der Invaliditätsgrad würde theoretisch 120 % betragen, doch die Auszahlung der Unfallversicherung ist meist auf 100 % begrenzt.
ABER Achtung: Es gibt auch viele Verletzungen und viele Dauerschäden durch Unfälle, die in der Gliedertaxe nicht erfasst sind. Dann muss eine individuelle Bewertung der Beeinträchtigung und des Invaliditätsgrades stattfinden, die häufig nur ein entsprechend spezialisierter Arzt vornehmen kann.
Gerechtigkeit ist unser Antrieb
Unfallversicherung: Was sollten Versicherungsnehmer beachten?
Versicherungsnehmer müssen einige wichtige Punkte beachten, um Ansprüche auf Invaliditätsleistungen geltend zu machen:
Rechtzeitige Meldung des Unfalls bei der Versicherung
Der Unfall muss der Versicherung unverzüglich gemeldet werden, in der Regel innerhalb einer Frist von 7 bis 14 Tagen. Dies ist in den Versicherungsbedingungen der Unfallversicherung festgelegt. Auch wenn der Unfall zunächst harmlos erscheint, sollte er sicherheitshalber der Versicherung gemeldet werden.
Das ist auch deswegen besonders richtig, weil Unfallversicherungen eine Pflicht zur Belehrung haben, die sie nur erfüllen können, wenn Ihnen auch der Unfall entsprechend vom Versicherungsnehmer gemeldet wurde.
Beachtung der Invaliditätsfrist
Die Invalidität muss in der Regel innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall ärztlich festgestellt und der Unfallversicherung schriftlich gemeldet werden. Diese Frist ist entscheidend, da ein verspäteter Nachweis dazu führen kann, dass die Versicherung die Leistung bei Invalidität verweigert. Welche Frist Sie mit Ihrer Unfallversicherung vereinbart haben, sollten Sie in den Versicherungsbedingungen der Unfallversicherung prüfen. Es ist sehr wichtig, dass diese Frist zur Meldung der Invalidität eingehalten wird, da sie als eine sogenannte Notfrist dazu führen kann, dass die Versicherung leistungsfrei wird.
Ärztliche Gutachten und Dokumentation
Eine umfassende ärztliche Dokumentation für die Unfallversicherung ist essenziell. Dazu gehören Berichte über den Unfallhergang, Diagnosen, Behandlungen und den festgestellten Grad der Beeinträchtigung. Versicherte sollten sich von Anfang an darum bemühen, alle relevanten Unterlagen zu sammeln.
Kommunikation mit der Unfallversicherung
Alle Meldungen und Anfragen gegenüber der Unfallversicherung sollten schriftlich oder in Textform (E-Mail) erfolgen, um einen Nachweis über den Austausch mit der Versicherung zu haben. Versicherte sollten Fristen der Unfallversicherung genau einhalten und bei Unklarheiten rechtzeitig nachfragen.
Invalidität: Einwendungen der Versicherung
Versicherungen versuchen häufig, Invaliditätsansprüche abzuwehren oder zu mindern. Dazu erheben sie typische Einwendungen, wie:
Mitwirkung von Vorerkrankungen
Unfallversicherungen können argumentieren, dass die Beschwerden auf eine Vorerkrankung zurückzuführen sind und nicht ausschließlich durch den Unfall verursacht wurden.
Beispiel: Ein Versicherter bricht sich bei einem Unfall die Wirbelsäule und klagt über dauerhafte Schmerzen. Die private Unfallversicherung verweist auf eine bereits vor dem Unfall diagnostizierte Osteoporose, die den Heilungsverlauf beeinträchtigt haben soll.
Verzögerte Meldung durch den Versicherungsnehmer
Die Versicherung verweigert die Leistung, weil die Invalidität nicht rechtzeitig innerhalb der Frist von 15 Monaten nachgewiesen wurde.
Beispiel: Nach einem Sturz bemerkt der Versicherte erst nach 18 Monaten, dass seine Hand dauerhaft steif bleibt. Die Versicherung lehnt die Zahlung trotz Invalidität ab.
Kein Unfall im Sinne der Bedingungen
Die Versicherung stellt grundsätzlich infrage, dass der Vorfall als Unfall zu werten ist.
Beispiel: Ein Versicherter verstaucht sich bei einer ungewohnten Bewegung das Knie. Die Versicherung argumentiert, dass es sich um eine spontane gesundheitliche Beeinträchtigung ohne äußere Einwirkung handelt.
Gutachterliche Meinungsverschiedenheiten
Die Versicherung stützt sich auf ein Gutachten, das einen geringeren Invaliditätsgrad ausweist.
Beispiel: Ein vom Versicherer beauftragter Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass die Beweglichkeit der Schulter nicht vollständig eingeschränkt ist, obwohl der behandelnde Arzt eine dauerhafte Funktionseinschränkung attestiert hat.
Gerechtigkeit ist unser Antrieb
Tipps für Versicherungsnehmer bei Streitigkeiten mit der Unfallversicherung
- Einsicht in die Akte nehmen: Versicherte können die Entscheidungsgrundlagen der Versicherung einsehen und überprüfen.
- Rechtsbeistand einschalten: Ein Fachanwalt für Versicherungsrecht kann helfen, Ansprüche durchzusetzen.
- Ein unabhängiges Gutachten einholen: Ein weiteres Gutachten kann zur Klärung der Invalidität beitragen.
- Beschwerde einreichen: Falls ein Einvernehmen mit der Versicherung nicht möglich ist, können Versicherte sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden. Bei Streitigkeiten über die Höhe der Leistung, etwaigen Vorerkrankungen, bereits bestandenen Dauerschäden oder Ausschlüssen etc. kann der Ombudsmann aber häufig nicht helfen. Er kann nämlich selbst keine Gutachten einholen und daher nur reine Rechtsfragen entscheiden.
Fazit Invalidität in der privaten Unfallversicherung
Invalidität in der privaten Unfallversicherung ist ein komplexes Thema, bei dem die Beachtung von Fristen, eine sorgfältige Dokumentation und die genaue Kenntnis der Versicherungsbedingungen von entscheidender Bedeutung sind. Versicherungsnehmer sollten proaktiv handeln und sich im Zweifel professionelle, rechtliche Unterstützung holen, um ihre Ansprüche gegenüber der Unfallversicherung durchzusetzen. Indem sie als Versicherungsnehmer gut vorbereitet sind, können sie typische Einwendungen der Versicherer effektiv entkräften und die finanziellen Leistungen im Fall einer Invalidität erhalten, die ihnen zustehen.